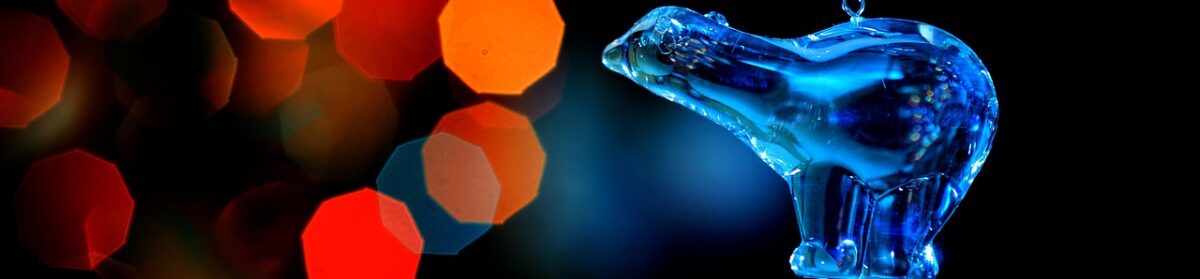„Unermüdlich kämpfte sie gegen Rassismus, Ausgrenzung, Hass. Und je älter Margot Friedländer wurde, desto wichtiger wurde sie für dieses Land.“ So hat Christoph Amend seinen Nachruf auf Zeit Online für jene Überlebende des KZ Theresienstadt eingeleitet, die nach ihrer Befreiung zwar zunächst nach Amerika emigrierte, aber wieder nach Deutschland kam, um mit Ausdauer und Menschlichkeit nicht nur in Schulen als Zeitzeugin zu wirken. Bewunderung und Dankbarkeit finden sich in allen erreichbaren Nachrufen.
Auf Zeit Online gefunden und mit Dank weitergereicht:
Tod von Margot Friedländer: Sie war so sehr Mensch
In ihren letzten Lebensjahren gewann Margot Friedländer als Botschafterin für die Menschlichkeit überlebensgroße Bedeutung. Eine Erinnerung
Von Götz Hamann
10. Mai 2025, 16:13 Uhr 96 Kommentare
Die fünfstöckige Torte, vor der Margot Friedländer an ihrem 102. Geburtstag stand, war fast halb so groß wie die zierliche Frau. Wie immer hatte sie in eine repräsentative Privatvilla geladen, die nicht ihre eigene war, die Gäste waren in der großzügigen Küche zusammengekommen. Die Torte, ein erbackenes Kunstwerk von Martin Werthmann, stand auf der Kochinsel, und als alle Kerzen angezündet waren, begannen die Gäste Viel Glück und viel Segen zu singen. Friedländer, in der Mitte stehend, das Gesicht auf Höhe der Kerzen, war hell erleuchtet. Sie lächelte. Neben ihr stand der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, und nachdem das Lied zu Ende war, alle applaudiert und gejubelt hatten, bliesen die beiden gemeinsam die Kerzen aus. Also sie versuchten es. Denn es waren 102 Kerzen, die auf dem Tortenplateau wie ein dichter Wald zusammenstanden. Schließlich schafften sie es doch.
Dieser Moment ist wie eine Metapher für das, was Margot Friedländer für viele Menschen in Deutschland war. Ein Mittelpunkt. Ein Licht. Wie viele Leben in Berlin und in ganz Deutschland hat sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten wohl bereichert? Seitdem sie, nach mehr als sechs Jahrzehnten in New York, 88-jährig in ihre Heimat Berlin zurückgekehrt war. Als ich sie vor zwei Jahren besuchte, holte Margot Friedländer irgendwann einen großen Stapel Kalender aus einer Schublade, sie legte sich die Bücher auf den Schoß, begann zu blättern. Auf den Seiten war notiert, wo sie überall schon gesprochen hatte und aufgetreten war, in wie vielen Schulen Margot Friedländer ihre Geschichte erzählt hatte. Ihre Geschichte, wie sie sich als deutsche Jüdin vor den Nationalsozialisten verstecken musste, wie sie später im Konzentrationslager Theresienstadt überlebte – und wie sie gerettet wurde. Als einzige ihrer direkten Familie überlebte Friedländer die Schoah.

Botschafterin der Herzensbildung
Ihr Überleben sollte einen Sinn haben, entschied Friedländer. Sie wollte Kinder und Jugendliche für ihre Botschaft gewinnen, menschlich zu handeln, damit so etwas wie während der Gewaltherrschaft der Nazis nie wieder geschehen kann: der Mord an sechs Millionen Juden und vielen anderen mehr, die Friedländer nie zu erwähnen vergaß. Sie war eine Botschafterin der Herzensbildung. Der Historiker Michael Wolffsohn hat kürzlich gesagt, für Herzensbildung brauche es kein Wissen, brauche es keinen Universitätsabschluss. Herzensbildung setze früher ein. Margot Friedländer hat genau das getan: Sie hat zur Herzensbildung von vielen Hunderttausend Deutschen beigetragen.